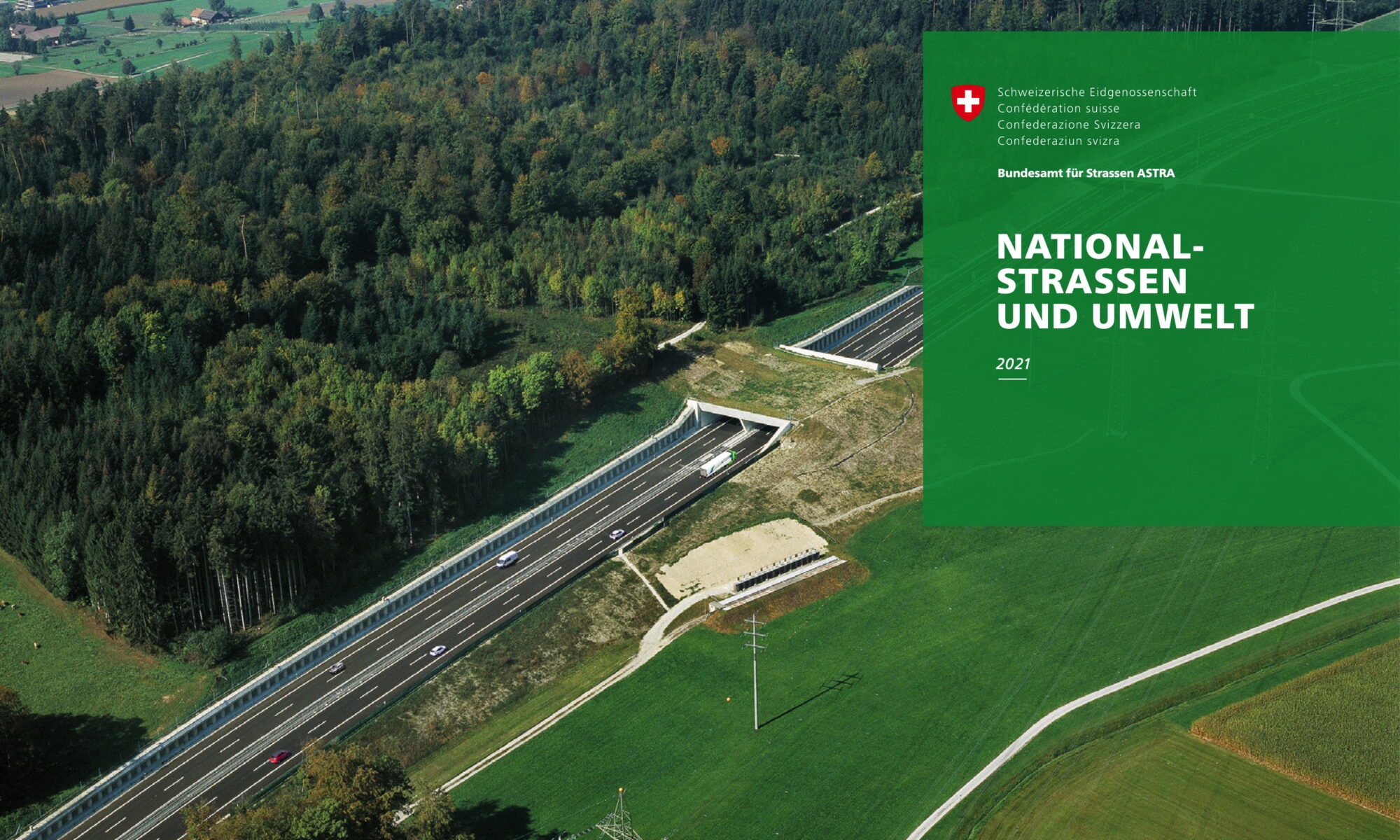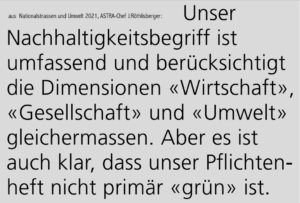Karl Lüönd, langjähriger Publizist und Kenner der Schweizer Medienlandschaft nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Beobachter-Interview nennt er deutsch und deutlich Gründe für die besorgniserregenden Entwicklungen in der schweizerischen Medienlandschaft. Das hindert ihn aber nicht, zähneknirschend und schwer seufzend ein JA zum Mediengesetz zu empfehlen. Diese Volte ist schwer nachvollziehbar, wird aber im öffentlichen Diskurs – vor allem im linksgrünen Lager – eifrig nachgetanzt.
So beschreibt Lüönd etwa das lukrative Geschäftsmodell von Grossverlagen wie Ringier oder der TX Group, welche die rentablen Unternehmensteile «kunstvoll aus der unwirtschaftlichen publizistischen Landschaft herausoperiert haben und jetzt der Öffentlichkeit vorjammern würden, «dass die Werbevolumina im Print massiv zurückgegangen sind. Wenn sie es nun noch schaffen, die rentablen Unternehmensteile in einem attraktiven Verbund an die Börse zu bringen, dann werden die Hauptaktionäre von Multimillionären zu Milliardären.»
Der Trick ist altbekannt und hat sich längst bewährt: Die Gewinne werden privatisiert, für den Rest soll die Öffentlichkeit aufkommen – in diesem Fall für den redaktionellen Teil des Mediengeschäfts, den Versand und die Zeitungsverträger:innen, die einst selbstverständlich durch dicke Stellenanzeiger und Autoinserate quersubventioniert wurden. Dann kamen den Verlegern die neoliberalen Prediger zu Hilfe: Quersubventionierung darf nicht sein. Alles was rentiert, abspalten und die Gewinne separat einsacken. Für den Rest stimmt der Verlegerchor Jammergesänge an und klagt bettelnd im Bundeshaus um grosszügige Almosen, weil mit Medien kein Geld mehr zu verdienen sei.
Dazu gibt es aus meiner Sicht nur eine Antwort: Nix da! Aber genau dies soll jetzt mit dem Medienpaket noch befördert werden. Es ist erschreckend, wie viele sich links, grün oder gar progressiv rühmende Zeitgenoss:innen kritiklos und polemisch für ein Gesetz werben, das dieser neoliberalen Praxis Tür und Tor öffnet.
Damit nicht genug, denn das Medienpaket befördert weitere Fehlentwicklungen. So schreibt etwa Karl Johannes Rechsteiner, Kommunikationschef der Katholischen Kirche im Kanton Bern, in einem Post auf Social Media:
«Die Medienschaffenden gehen schlicht vergessen vor lauter Förderung der profitablen Grossverlage – wie können Millionen-Subventionen geplant werden angesichts der Ausbeutung von Schreibenden etwa durch miserable Honorare und rücksichtslose Missachtung von Urheberrechten? Warum werden die Gelder nicht an einen neuen GAV gebunden?»
Diese Frage ist mehr als berechtigt. Der vielstimmige Lobgesang auf die Lokalmedien und deren unverzichtbare Leistungen für die Demokratie tönt falsch in meinen Ohren. Aus eigener Erfahrung weiss ich: Die lokale Berichterstattung fristet seit jeher ein Mauerblümchendasein. Schon zu meinen Anfangszeiten als Journalistin in den 1980er Jahren war es gang und gäbe, dass nicht Journalist:innen, sondern Lehrpersonen und Pensionierte für ein Trinkgeld über das lokale Geschehen berichteten. Heute begnügt man sich bei der aus politischem Kalkül mit Krokodilstränen so eifrig verteidigten Lokalpresse allzu oft damit, bloss die Medienmitteilungen von Behörden und Firmen abzudrucken. Hand aufs Herz: Es gibt sie, die gute und wertvolle Lokalberichterstattung – aber sie ist heute mehr die Ausnahme als die Regel. Leider.
Das hat natürlich (auch) finanzielle Gründe. Martin Rothenbühler, Präsident von AVIVO Bern, beschreibt es in einem Post auf Facebook wie folgt:
«Und dann gibt’s noch die Seite der Behörden. Jedes Amt, jede Kommission, jeder Politiker, jede Politikerin, jeder Verband, ja sogar jede NGO kommt heute nicht mehr aus ohne einen, zwei, drei Medienbeauftragte. Gute, erfahrene – aber schlecht honorierte – Journalist:innen wechseln die Seite. Allein die Bundesverwaltung, die ich sehr gut kenne, weist Heerscharen von Medienbeauftragten auf, darunter exzellente Leute. (Was das kostet!)»
Auch Karl Lüönd sieht in diesem Punkt einen wesentlichen Schwachpunkt der aktuellen Medienlandschaft und geizt diesbezüglich nicht mit markigen Worten:
«Ein Heer von Fassadenreinigern und Leichenschminkern hat nicht nur in den Firmen, sondern auch in den Ämtern und öffentlichen Einrichtungen, von der Kantonspolizei bis zum Kunsthaus, die Herrschaft übernommen. Jede Dienstabteilung auf der Verwaltung hat heute eine ganze Medienabteilung. (…)
Diese Kommunikationsleute schminken die Leichen, die ihre Organisationen im Keller haben, damit die Öffentlichkeit meint, sie seien noch lebendig. Sie beanspruchen die Deutungsmacht und kontrollieren den Zugang zu den Wissensträgern.»
Diese Entwicklung erschwert die journalistische Arbeit, auch hier schreibe ich aus eigener Erfahrung: Während man einst Politiker:innen, Expert:innen und Fachpersonen in der Verwaltung direkt befragen und zitieren konnte, führt heute kein Weg an der Medienfachstelle vorbei. Diese glättet, selektiert und zensuriert in der Regel, was das Zeug hält.
Auch dazu noch einmal Karl Lüönd:
«Ich hatte ein paar Mal in meiner Karriere Zugang zum Topmanagement von grossen Firmen und habe deren Denkweise miterlebt. Die Medienabteilungen sind für sie eine Art von Werkschutz. Sie sollen den Entscheidungsträgern die hartnäckigen Journalistinnen und Journalisten vom Hals halten und sie mit geschliffenen Sätzen abspeisen. Früher konnte ich als Journalist in der Verwaltung oder in einer Firma direkt die verantwortliche Fachperson anrufen. Das ergab dann einen interessanten Medienbericht aus erster Hand. Heute müssen die Journalisten eine schriftliche Anfrage an eine Pressestelle schicken. Was herauskommt, ist oft offizielles Blabla.»
Einen weiteren Punkt, der in der gegenwärtigen Polemik ebenfalls unter den Tisch gekehrt wird, ist die unsägliche Verteilung von Millionen an die Zeitungsvertriebsgesellschaften: Dass die Zeitungsverträger:innen, die bei jedem Wetter zu nachtschlafener Zeit unterwegs sind, nur einen Hungerlohn erhalten, ist seit Jahren ein Skandal. Ganz abgesehen davon, dass diese Schande auch ohne neues Mediengesetz längst ausgemerzt werden müsste, ist die Papierzeitung auf dem Frühstückstisch ein Auslaufmodell. Auch ich gehöre der Generation an, die einst glaubte, ohne Zeitungslektüre sei der Morgenkaffee ungeniessbar. Weit gefehlt! Wir sind weder schlechter informiert, noch starten wir unglücklicher in den Tag, seit wir (aus politischen Gründen) unsere Abonnements der gedruckten Tageszeitungen gekündigt haben. Wer sich in seinem Umfeld umhört stellt zudem fest: Es gibt kaum Menschen unter 40 Jahren, die noch Tageszeitungen auf Papier lesen…sogar die Pendler:innen verweilen sich lieber mit ihrem Smartphone als mit 20-Minuten-Papier.
Und wem dies an Infos noch nicht reicht, hier noch ein Argument gegen das Medienpaket: Peter Salvisberg, ehemalige Chefredaktor von Schweizer Radio International («swiss-info») und Geschäftsleitungsmitglied der Konsumenteninfo AG schreibt:
«Profitieren würde.… die Post. Diese hat nämlich bereits angekündigt, dass sie per 1.1.22 und in den folgenden drei Jahren pro Jahr pro Expl. Ihre Zustellungsgebühren um 1,8 Rappen erhöht. Damit werden die 8–9 Rappen mehr, welche uns das Mediengesetz bringen wird, gerade wieder weggefressen. Medienförderung=Postförderung…und niemand thematisiert diesen Zusammenhang. Das UVEK gibt’s via Bakom mit der rechten und nimmt’s via Post mit der linken Hand.»
Und für den Rest machen Coninxes, Ringiers und Co. die hohle Hand. Unterstützt von der WoZ, der Republik, Infosperber und wie sie alle heissen.