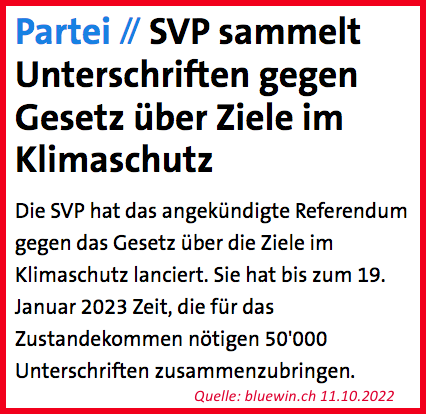Es ist höchste Zeit, die Ölheizung stillzulegen und durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Dass man damit für das alte Haus mehr Strom braucht, ist kein Problem: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und die Speicherbatterie im Keller sorgen künftig für eine autarke Versorgung mit erneuerbarer Energie, rund um die Uhr.
«Damit wird auch das Wohnen sauber», freut sich die ökologiebewusste Mieterin. Ihre Nachbarn haben soeben eine Pelletheizung installiert, andere hoffen auf einen baldigen Fernwärmeanschluss. Der Trend ist klar: Alle wollen weg von Gas und Öl. Endlich!
Das ist gut so, der Schritt weg von den fossilen Energien war längst überfällig – aber wie sauber ist die «saubere Energie» wirklich? Sind die landauf landab propagierten Alternativen tatsächlich gut genug? Schaffen wir es damit aus der aktuellen Sackgasse?
In der allgemeinen Euphorie für Alternativen zu Öl- und Gaskraftwerken sowie fossilen Heizanlagen werden die Schattenseiten der Ersatz-Technologien unter den Tisch gewischt, mitunter wird auch gelogen und betrogen, was das Zeug hält.
Ein krasses Beispiel dafür ist etwa die Umstellung des grössten Stromkraftwerks in England von Kohle auf Pellets. Damit erhält dieser Strom das Label «grün», weil er mit Holz – einem nachwachsenden Rohstoff – produziert wird.
Wie die BBC in ihrem Dokfilm «The Green Energy Scandal Exposed» aufzeigt, ist das Verheizen von Pellets in diesem Massstab jedoch alles andere als nachhaltig: Der Kraftwerksgigant verbrennt jährlich sieben Millionen Tonnen Pellets – der Grossteil davon wird aus Kanada herangeschifft. Das Holz stammt zu einem guten Teil aus Urwäldern im hohen Norden, die sehr viel CO2 binden und bekanntlich viel länger brauchen, um nachzuwachsen als Wälder in wachstumsfreundlicheren Umgebungen.
Money makes the pellets go round – Distanzen und Transport spielen keine Rolle, wenn der Energiemarkt soviel bezahlt, dass das Pelletbusiness Profit abwirft.
Dies notabene mit grosszügiger Unterstützung durch den britischen Staat, der die Verfeuerung von Pellets anstelle von Kohle als «grüne Alternative» subventioniert! Wer zudem meint, Pellets seien immerhin «besser» als Kohle, sitzt offenbar einem Märchen auf. Seit die Drax Power Station im englischen Yorkshire Holzpellets verfeuert, weist sie laut Recherchen der BBC eine CO2-Bilanz auf, die noch schlechter ausfällt als der einstige Kohlebetrieb.
Auch in der Schweiz wird die Umstellung auf Pelletheizungen subventioniert. Weil wir (noch!) genügend Holz haben, das sich für die Energieerzeugung eignet, so die Werbesprüche. Allerdings stossen Pelletheizungen nach wie vor eine Menge CO2 und zusätzlich Feinstaub aus. Kommt hinzu, dass es auch hierzulande bloss eine Frage der Zeit ist, bis die heimische Pelletproduktion die Nachfrage nicht mehr befriedigen kann.
In der Abteilung «saubere» Energieproduktion finden wir sodann Solar- und Windkraft. Beide sind in Wahrheit nicht ganz so sauber, wie es deren Promotoren gerne verkünden: Für die Herstellung von Wärmepumpen und ‑sonden, Photovoltaikanlagen, Windturbinen und Batterien werden Rohstoffe benötigt, deren Gewinnung die Umwelt belastet und die noch weit davon entfernt sind, in eine Kreislaufwirtschaft eingebunden zu sein. Unter dem Strich also Energieanlagen, die schon eine Menge Energie gekostet haben, bevor sie überhaupt in Betrieb gehen.
Noch wissen wir wenig über deren Lebensdauer. Fest steht: Keine dieser Anlagen ist ein Perpetuum Mobile. Bei Windkraftturbinen spricht man von einer Betriebsdauer von rund 20 Jahren, in der Vergangenheit war es auch schon weniger. Bei Photovoltaikanlagen werden 25 bis 40 Jahre prognostiziert, bei Wärmepumpen 15 bis 20 Jahre.
Klar kann man hoffen, dass dank Forschung und Entwicklung in Zukunft auch die Energiegewinnung immer effizienter und sauberer wird, und dass dies die kurzen Lebenszyklen der Anlagen aufwiegen mag.
Trotzdem: Saubere Energie gibt es nicht. Man muss beim Vergleichen von mehr oder weniger sauberen Energieformen sogar höllisch aufpassen und genau rechnen, bevor das Etikett «sauberer als…» aufgeklebt wird.
Wohlstand auf dem Niveau unserer hochindustrialisierten Länder mit stetig wachsender Mobilitätssucht lässt sich nicht grünsanieren. Ohne Erkenntnis und Akzeptanz, dass weniger mehr ist, wird das Erreichen der Klimaziele ein frommer Wunsch bleiben. Dies umso mehr, wenn zuoberst auf der Traktandenliste der Mächtigen das Führen von Kriegen steht.